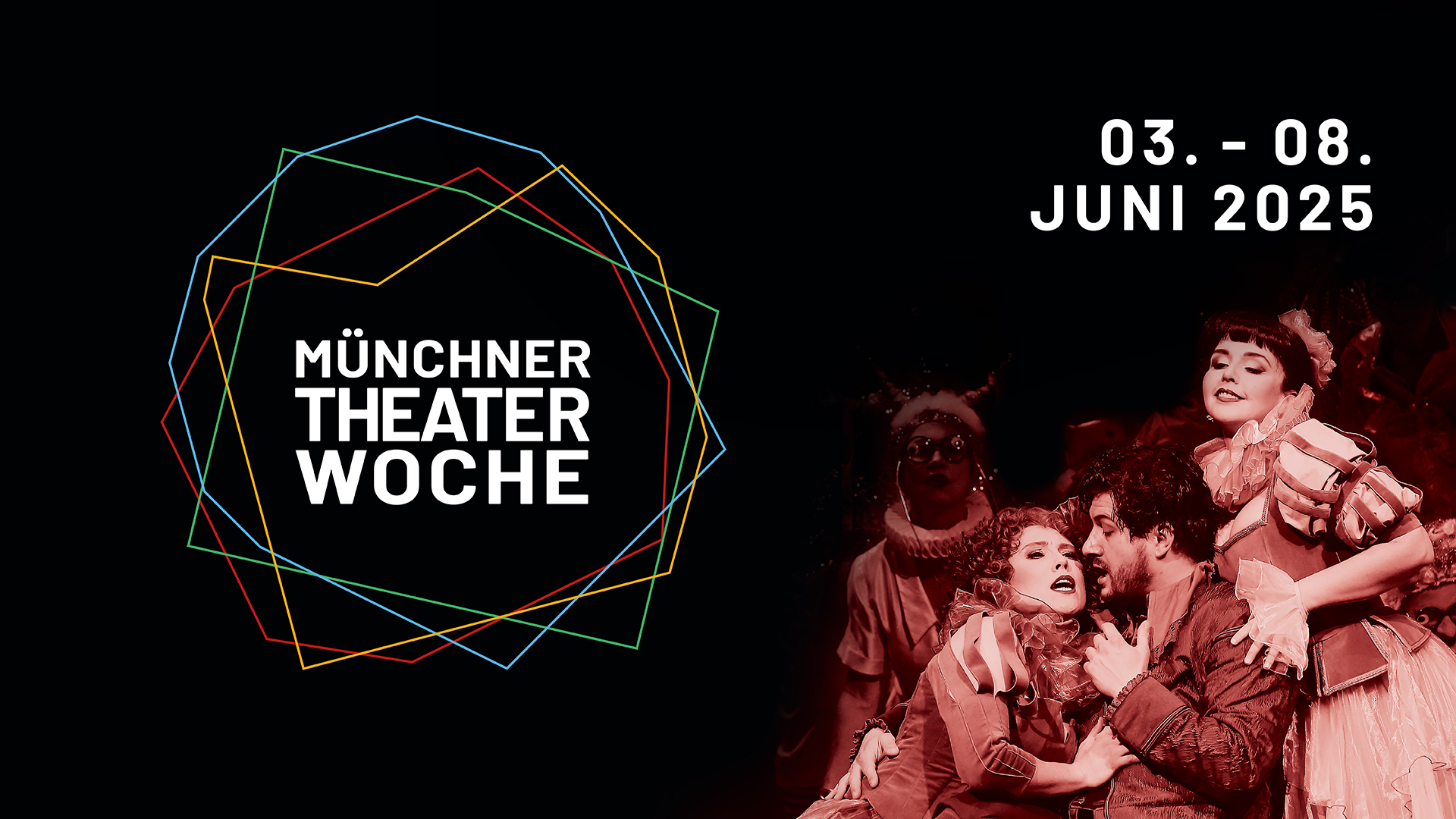Theater in München
Eine Einführung
1927 veröffentlichte Oskar Maria Graf seine Erinnerungen „Wunderbare Menschen“. Darin erzählt er von seiner Zeit als Dramaturg an der Neuen Bühne (1920) und seinem leidenschaftlichen Einsatz für den Erhalt dieses einfachen Arbeitertheaters, das auf rein genossenschaftlicher Grundlage bestand. Sein Ziel: Die prestigeträchtige Kunstform des Theaters auch jenen zugänglich machen, denen sie oft verwehrt blieb – den „wunderbaren Menschen“, der arbeitenden Stadtbevölkerung, die den Theatersaal im Hinterhof der einfachen Wirtschaft füllte.
Ob nun von Fürsten, Genossenschaften oder der Stadt initiiert: Theater hat in München lange Tradition. Bereits im 16. Jahrhundert lud der Hof Schauspieler:innen in die Residenz, 1657 eröffnete mit dem Opernhaus am Salvatorplatz das erste Gebäude seiner Art in Deutschland. Es folgten das Cuvilliés-Theater (1753) und das Königliche Hof- und Nationaltheater (1818), das heute die Bayerische Staatsoper beherbergt. Das Staatstheater am Gärtnerplatz (1865) ist für Operetten und Singspiele bekannt, das Deutsche Theater (1896) für Musical und Shows.
Auch das Sprechtheater gewann an Bedeutung: 1806 entstand das Königliche Hofschauspiel, das nach der Monarchie als Bayerisches Staatsschauspiel weitergeführt wurde – mit dem Residenztheater als heutiger Spielstätte. Kinder und Jugendliche finden in der Schauburg oder dem Münchner Theater für Kinder ein breites Angebot. Die Münchner Kammerspiele (1912) wurden in den 1950er Jahren mit Bertolt Brecht zum Zentrum politisch engagierender Theaterkunst.
Neben den großen Bühnen wuchs eine lebendige freie Szene: In der Nachkriegszeit prägten Theater wie das Antitheater (1968, u. a. mit Rainer Werner Fassbinder) und das politische Kabarett „Die Elf Scharfrichter“ (1901) die Szene. Aber die Zahl der privaten Bühnen schwankt: Von 42, die es 1989 gab, sind heute noch 18 aktiv, darunter das Blutenburg-Theater oder das Münchner Marionettentheater.
Neue Initiativen gibt es immer: Häuser wie die Pasinger Fabrik oder das Kreativquartier bieten Raum für Experimente, doch Kürzungen im Kulturbudget bedrohen die Bühnen.
Egal ob hunderte oder einige Dutzend Sitzplätze, in Zeiten von Kürzungen der öffentlichen Kulturetats kann Kunst ohne Besucher:innen nicht lange überleben.
Auch die Neue Bühne musste nach etwas mehr als einem Jahr schließen. Das hinderte Oskar Maria Graf aber nicht daran, wohlwollend zurückzublicken.
Bis heute erzählt seine heitere Chronik der Arbeiterbühne nicht nur, warum Theater in dieser Stadt gemacht wird, sondern vor allem für wen. Appellierend schreibt er:
„Werbt für euer Theater, denn es ist für euch und wegen euch,
es gehört jedem von euch!“